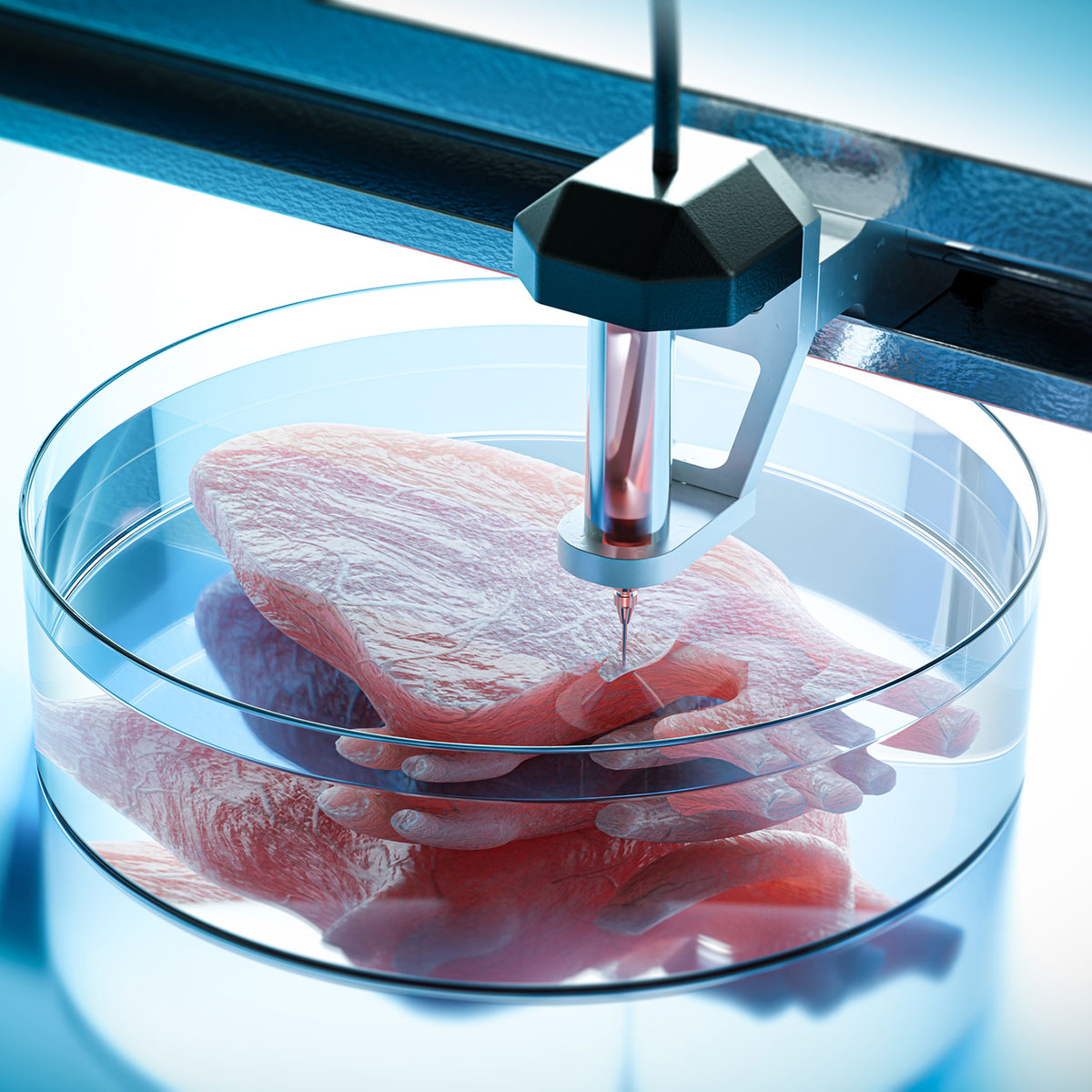Lesedauer: 6 Minuten

Wurst- und Fleischfabrik mit Hackebeil und Säge – das war einmal. Wer kann die alten Bilder noch abrufen? Heute sehen die Produktionsstufen völlig anders aus: High-Tech-Labore, in denen Fleischprodukte mit höchster Präzision und Hygiene zugeschnitten, geformt, analysiert und verpackt werden. Sensoren piepen, Roboterarme greifen, Kameras überwachen jeden Schritt, und auf Bildschirmen laufen die Daten in Echtzeit.
Dank Software und KI können Maschinen inzwischen vieles „mitdenken“ – sie nehmen den Menschen Arbeit ab und verändern gleichzeitig deren Rolle. Die früheren Bediener arbeiten nun anders mit den Anlagen zusammen: Sie reagieren auf optische oder akustische Signale, geben Produktionsschritte über ein intuitives Display frei, während parallel der Ingenieur am selben Bildschirm Echtzeitdaten abruft und die Vernetzung der Maschinen bis in die Lieferkette überprüft.
„Industrie 4.0“ und „Internet der Dinge“ – Begriffe, die heute fast altmodisch klingen – sind in der Fleischwarenproduktion längst Realität. Und immer deutlicher wird, wie viel Potenzial in dieser neuen Zusammenarbeit von Mensch und Maschine steckt.
Deutsche Fleischwarenfabriken – immer smarter, immer intelligenter

Deutsche Firmen spielen bei Innovationen in Automatisierung und Digitalisierung ganz vorne mit. Im Rahmen der IFFA Factory Show wurden moderne Technologien vorgestellt, die Prozesse entlang der gesamten Fleischverarbeitungskette vereinfachen und automatisieren. Besonders vielversprechend: Das Zusammenspiel von KI mit altbekannten Produktionsschritten. Bei CSB in Geilenkirchen ist manches von der Kompetenz des Metzgermeisters an eine KI übergegangen – den „CSB Image Meater“ und den „CSB Eyedentifier“, die Fleischstücke per visueller Analyse schon am Wareneingang erkennen und rückverfolgbar machen, Zerlegeausgang, Produktion und Verpackungsprozesse steuern und am Ende die Handelsklasse und den Handelswert ermitteln.
Pintro hat die Herstellung der Wurstschnecke vollautomatisiert und damit die Produktionszeit halbiert, in dem sie es nach dem Pick & Coil Prinzip Robotern überlassen, die Würstchen vor dem Aufrollen richtig hinzulegen.
Verpackungs-Straßen von Jasa können den Verpackungsmodus in fünf Minuten vollautomatisch wechseln (15 Minuten per Hand), die Produkte mit dem integrierten Drucker an der richtigen Stelle mit dem richtigen Text etikettieren und auf Änderungen von der Rezeptur selbstständig reagieren.
Sesotec erkennt mit seinen Röntgen- und Metalldetektionssystemen auf acht Linien gleichzeitig kleinste Verunreinigungen aus Glas, Kupfer und Edelstahl, aber auch Gummi, Knochen oder PVC und hat diese Vorgänge für die Bedienungsoberfläche so heruntergebrochen, dass sie von ungelernten Kräften überwacht werden können.

Auch bei Seydelmann in Stuttgart steht intuitive Bedienung ganze vorne, wenn der automatische Fleischwolf AE 103/3 die Steuerung der Schneideaufsätze so eindeutig ermöglicht, dass ungelernte Kräfte sie einsetzen können. Die Wirkung intuitiver Bedienpanels entfaltet sich besonders am Arbeitsmarkt der Fleischwarenhersteller.
Intuitive Human Machine Interfaces (HMIs) – viel mehr als Bedienflächen

Wie gut diese oft „wie von Geisterhand“ gesteuerten Prozesse funktionieren, hat entscheidend mit den HMIs zu tun, die zwischen Mensch und Maschine vermitteln. Diese Interfaces intuitiv zu gestalten, also ohne Ausbildungs- und Sprachbarrieren kinderleicht bedienbar zu machen, eröffnet den Firmen neue Möglichkeiten, weil sie mehr ungelernte Arbeitskräfte beschäftigen und gleichzeitig die gefragten Fachkräfte von Routineaufgaben entlasten können. „Unskilled Labour“ ist dafür zum geflügelten Wort geworden.
„Ich sehe sehr viel Potential darin, sprach- und kulturunabhängige Maschinen anzubieten, auch für die Exportmärkte. Piktogramme und Farbsysteme auf den Panels überwinden Barrieren, leisten mehr als Sprache.“ Raphael Hägle kommt als Berater des Fraunhofer Instituts viel in deutschen Firmen herum. Mit einem Team von Designern und Programmierern bietet er Unternehmen maßgeschneiderte HMI-Lösungen an. Er erzählt von einem Projekt, in dem ein Umrüstprozess von dem Facharbeiter auf die Bediener übertragen werden konnte, was zu einer hohen Zeitersparnis führte.
Bei aller Technisierung verfolgt Hägle dabei einen „menschzentrierten Ansatz“, der die konkrete Nutzererfahrung als Ausgangspunkt der Weiterentwicklung von Bediensprachen nimmt. „Maschinen werden mit einer funktionsorientierten Logik entwickelt und sollen auch so bedient werden“, greift er im Gespräch mit Foodtech Now! eine häufige, aber falsche Vorstellung auf. „In der Praxis nutzen Anwendende sie jedoch oft anders. Diese verschiedenen Sichtweisen greifen wir auf. Nicht die Funktionalität der Maschine, sondern die Aufgaben und die Herangehensweise des Nutzers sollten Ausgangspunkt jeder Maschinenbedienung sein.“ Ein ausführliches Interview mit Raphael Hägle vom Fraunhofer-Institut finden Sie hier.
84 Prozent der deutschen Maschinen gehen in den Export – was passiert dann?

Doch Spaziergänge durch deutsche Herstellerhallen reichen nicht, wenn man die Wirkung und die Potentiale von Technologie erfassen will. „84 Prozent der in Deutschland hergestellten Maschinen gehen in den Export, in Regionen und Länder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, wie beispielsweise den Mittleren Osten, Mexiko, Indonesien oder Nigeria“, zeichnet Beatrix Fraese vom Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen im VDMA ein größeres Bild. „Wir haben im Lebensmittelbereich viele rohstoffreiche Länder, die durch den Einsatz von Verarbeitungs- und Verpackungstechnologie die Wertschöpfung erhöhen können. Es macht einen Unterschied, ob beispielsweise Rohkakao oder schon verarbeitete Kakaomasse hergestellt wird, auch für den Maschinenbediener.“ Ein ausführliches Interview mit Beatrix Fraese vom VDMA finden Sie hier.
Automatisierung lässt sich nicht verordnen. „Es gibt viele Märkte, da kommt es auf jeden Euro an, da kann man nicht voll automatisieren“, sagt Hägle. Auf Deutschland bezogen bedeutet das für das Fraunhofer Institut gerade Mittelständlern, die sonst die Kosten scheuen würden, den Einstieg in Themen wie „Usability-Kompetenz“ zu erleichtern – weil diese auch kurzfristig Wirkung zeigen kann. „Wir müssen dabei immer darauf achten, dass die Maschinen mit den neuen ‘Extras’ nicht zu teuer werden und sich die Vorteile wirklich in Effizienzgewinnen realisieren“, ergänzt Hägle.
Auch Fraese differenziert: „Es hängt von den Reifegraden der Industrien ab. Wir haben Lebensmittelindustrien mit einer sehr starken, noch manuellen Komponente im Verarbeitungs- und Verpackungsprozess. Es gibt Lohngefüge, wo es durchaus stimmig ist, viele Menschen einzusetzen. Erst wenn das Lohngefüge höher wird, beginnen sich Automatisierungsprozesse zu rechnen.“
Wüstensturm, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit – und neue Maschinen

Szenenwechsel. Nigeria, Lagos. Luftfeuchtigkeit: 80 Prozent. Von November bis März bringt der Harmattan den Wüstenstaub aus der Sahara in die Städte. Er dringt überall ein, die Luftfeuchtigkeit tut das ihrige – und das tut Maschinen aus Deutschland oft gar nicht gut.
Eben van Tonder liebt Fleisch, Maschinen – und den Kontinent Afrika. Hier berät er Firmen, die sich im Lebensmittelbereich aufstellen, bei der Errichtung von Produktionsstätten. „Die Maschine verschleißt schon, wenn sie nur dasteht“, sagt van Tonder im Interview mit Foodtech Now!. „Die IP 65-Schutzhülle, mit der die Maschine ankommt, ist unzureichend“, sagt er. Er würde immer empfehlen, nicht eine große Maschine zu ordern, sondern fünf kleine: “Eine ist immer kaputt. Dann lässt sich das besser austarieren.“
Van Tonder kämpft einerseits mit der Herausforderung Arbeitskräfte ohne spezifische Ausbildung an Maschinen heranzuführen, andererseits kritisiert er die Hersteller, die trotz des starken Wachstums im afrikanischen Fleischmarkt zu wenig Verständnis für die lokalen Bedingungen zeigen.
Auch die intuitive Bedienweise greife hier noch nicht. „Was ist intuitiv?“, fragt van Tonder, „Der Umgang mit mechanischen Maschinen ist in Afrika oft ein anderer als in Europa. Fragt man einen Arbeiter nach seiner Methode, sagt er oft: ‘Weil ich es so mache.’ Manchmal besteht auch die Erwartungshaltung von Seiten der Arbeitskräfte, dass sich Probleme mit der Zeit von selbst lösen.“ Ein ausführliches Interview mit Eben van Tonder finden Sie hier.
Nicht nur die Maschinen sind Exportschlager – auch das Ausbildungssystem

Wie die Maschinen hat auch das weltweit fast einzigartige deutsche Ausbildungssystem das Zeug, ein toller Exportartikel zu werden. Strukturierte Ausbildungen, wie man sie in Deutschland finden kann, sind keine Stärke der USA. Deshalb sehen manche der europäischen Maschinenhersteller, die dort Werke errichten, die einzige Chance auf qualifiziertes Fachpersonal darin, ihre Mitarbeiter in eigenen Akademien selbst auszubilden.
Fraese sieht in der intuitiven Bedienbarkeit von Maschinen zwar kein richtiges Bildungsinstrument, aber eine Möglichkeit für weniger Qualifizierte einen Einstieg in Unternehmen zu finden und sukzessive zu lernen: „Menschen werden mit Tools konfrontiert, die sie gut bedienen können, weil viele Displays inzwischen Smartphones ähneln, die ihnen vertraut sind.“
Welche Maschinen wären denn richtig für Afrika? Um die Antwort ist van Tonder nicht verlegen: „Afrikanische Kunden wollen keine komplexen Speicherprogrammierbaren Steuerungen – sie wollen robuste Maschinen mit Direktantrieb, die sich einfach reparieren, warten, zusammenbauen und reinigen lassen. Möglichst simpel, mit bezahlbaren Ersatzteilen, die sofort verfügbar sind. Erfolgreich sind in Afrika nur Maschinen, die genau so funktionieren.“
Für weniger und einfachere „Technik“ hat auch Hägle im von Lagos weit entfernten Fraunhofer Institut einen Sinn: „Ja, es kann spannend sein, Maschinen so zu gestalten, dass sie wenig Automatisierung beinhalten – auch für Märkte, wo es entscheidend sein kann, einfache und robuste Lösungen zur Hand zu haben.“ Das heißt nicht, dass sich hier die Bedienung nicht vereinfachen ließe: „Auch für eine weniger automatisierte Maschine kann ich ein Bediensystem bauen, das mit Texten, Bildern und Animationen durch die Aufgabe führt. Und wenn sich nur mit einem Schraubenschlüssel etwas verändern lässt, dann wird das angezeigt.“