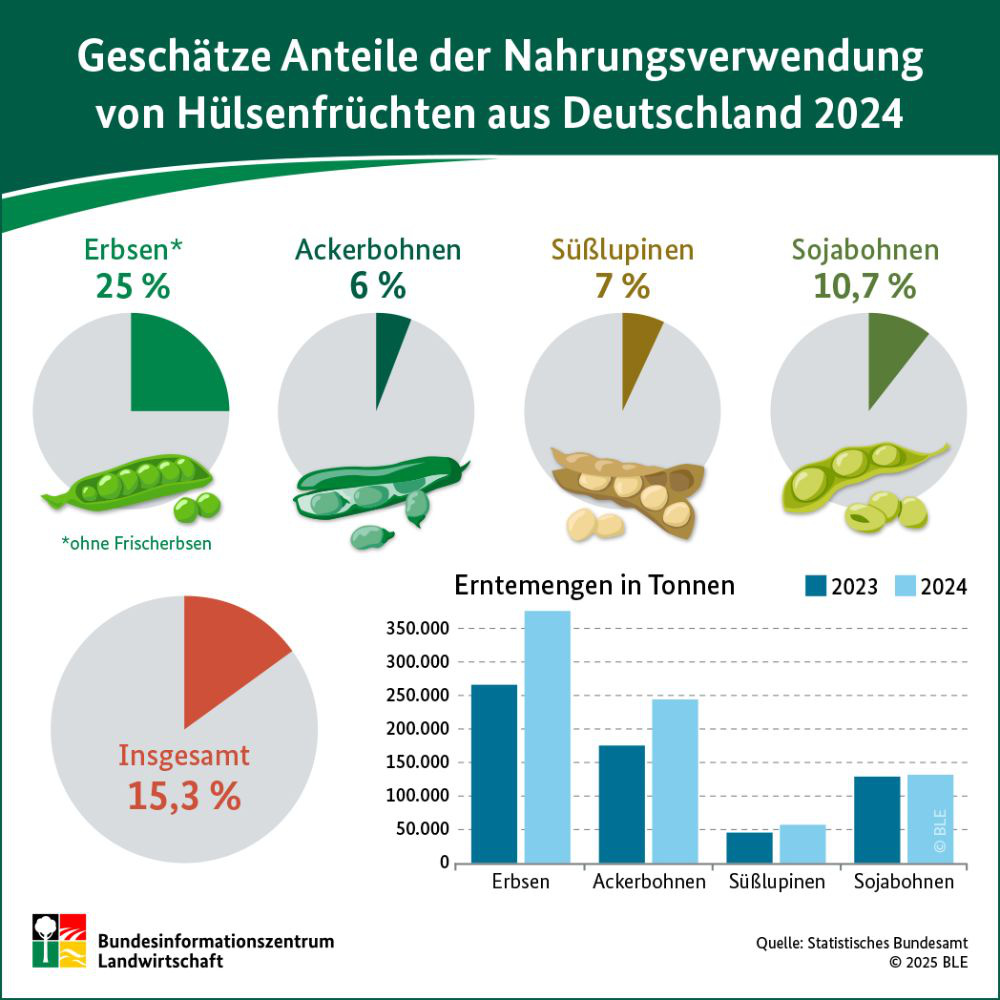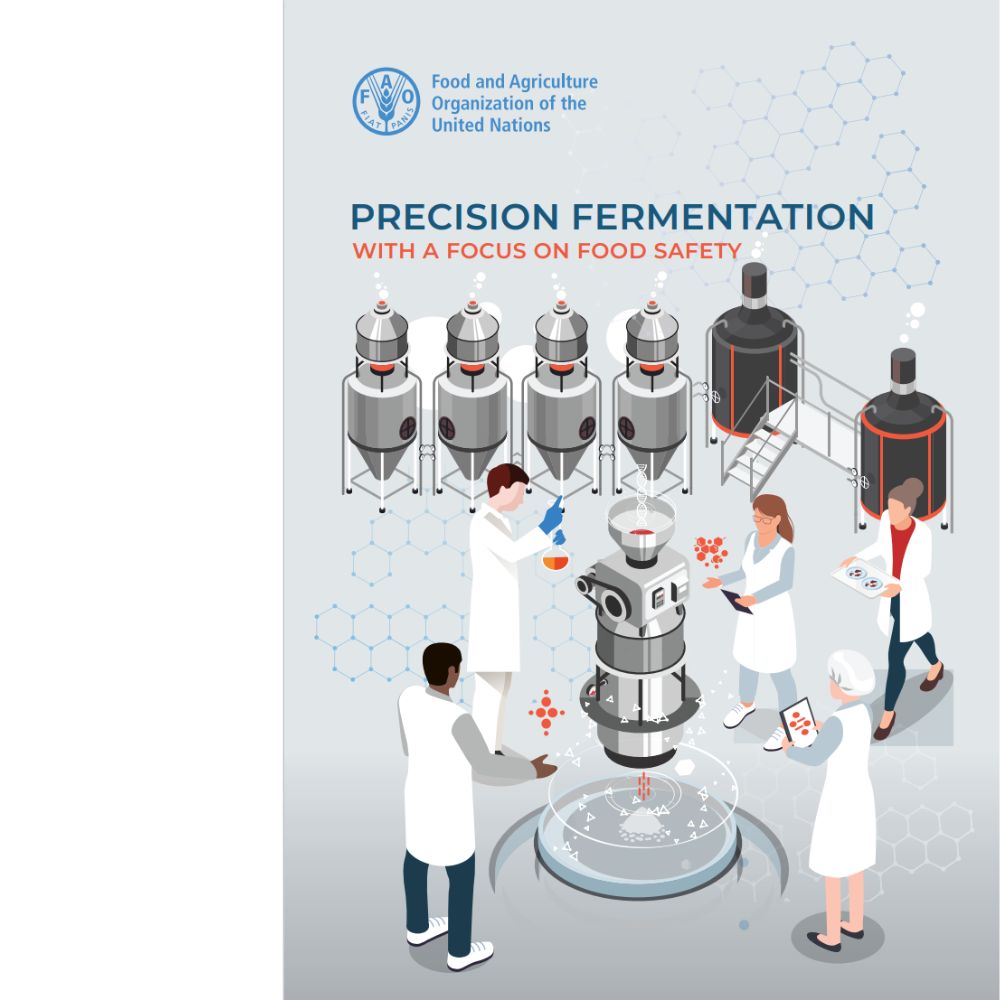Lesedauer: 4 Minuten

Sie beschreiben in Ihrem Buch Essgewohnheiten und Kulinarik in ihrer historischen Dimension. Wie sehr ist der Mensch ans Fleisch gebunden?
Gebunden sind wir daran weniger, als wir glauben. Wir sind schließlich Freiheitswesen, die nicht nur nach Genuss dürsten, sondern auch nach Unabhängigkeit. Abhängig sind wir von Fleisch nicht, denn aus einer rein funktionalen Perspektive lassen sich dessen lebensnotwendige und sättigende Bestandteile wie Proteine durch pflanzliche ersetzen. Es handelt sich vielmehr um eine individuelle und gesellschaftliche Orientierung. Wir haben die Wahl, ob, wie und in welchem Maß wir Fleisch verkosten. Unser Speiseplan ist auch Ausdruck demokratischer Errungenschaften und bürgerlichen Selbstverständnisses.
Aus Gründen des Klimas und des Bevölkerungswachstums scheint das tierische Fleisch ein Auslaufprodukt zu sein. Aber wie weit ist die Gesellschaft wirklich bei dieser Transformation?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und vergisst leider häufig, dass im Wandel nicht nur Arbeit, sondern auch ein Genussversprechen steckt. Der Blick in die Geschichte lohnt sich, da wir so feststellen, dass es auch vor uns schon couragierte Menschen gab, die mit ihrer Routine gebrochen und Vergnügen an der Kraft des Wandels gefunden haben.
„Lust an deftiger Kost – und gesundheitsbewusste Gerichte. Das sind seit jeher die beiden Pole der Ernährung.“
Gemäß Ihrer Expertise: Gibt es in der Geschichte einen vergleichbaren Wandel?
Mit den ersten Restaurants zur Zeit der Französischen Revolution entwickelten sich zwei Richtungen, die auch unsere heutige Zeit prägen: Lust an deftiger Kost und gesundheitsbewusstes Speisen. Die Legende besagt, dass ein gewisser Mr. Boulanger das erste Restaurant erfand. Er schrieb über dessen Portal: Ego restaurabo vos. Ich werde euch erquicken, und zwar mit Hammelfüßen in weißer Soße zum Beispiel. Nicht unbedingt leicht verdaulich [lacht], aber das schmeichelte wohl dem Gaumen damaliger Gäste. Das war die üppige Variante! Sein Konkurrent Mathurin Roze de Chantoiseau dagegen nannte sein Restaurant „Haus der Gesundheit“ und bot schmackhafte Bouillons an. Für eine Rückkehr zur Natur plädierte auch der Schweizer Arzt Samuel Auguste Tissot. In seinem Werk „Von den Krankheiten vornehmer und reicher Personen an Höfen und in großen Städten“ aus dem Jahre 1771 appellierte er an den Adel, einer ungesunden Lebensweise abzuschwören und Fleisch, Zucker sowie Genussmittel wie Kaffee, Tee und Alkohol nur in Maßen zu sich zu nehmen. Fleisch stand immer wieder in der Kritik. Allerdings gab es dabei kein Maß. Mit einer Rigorosität wurde verdammt oder vergöttert. Heute aber können wir aufgrund neuer Erkenntnisse in der Forschung und ausgereifter ernährungsphysiologischer Debatten klarer sehen, wie wir mit Fleischkonsum umgehen wollen.
„Heute können wir aufgrund ernährungsphysiologischer Forschung viel klarer sehen, wie wir mit Fleisch umgehen wollen.“
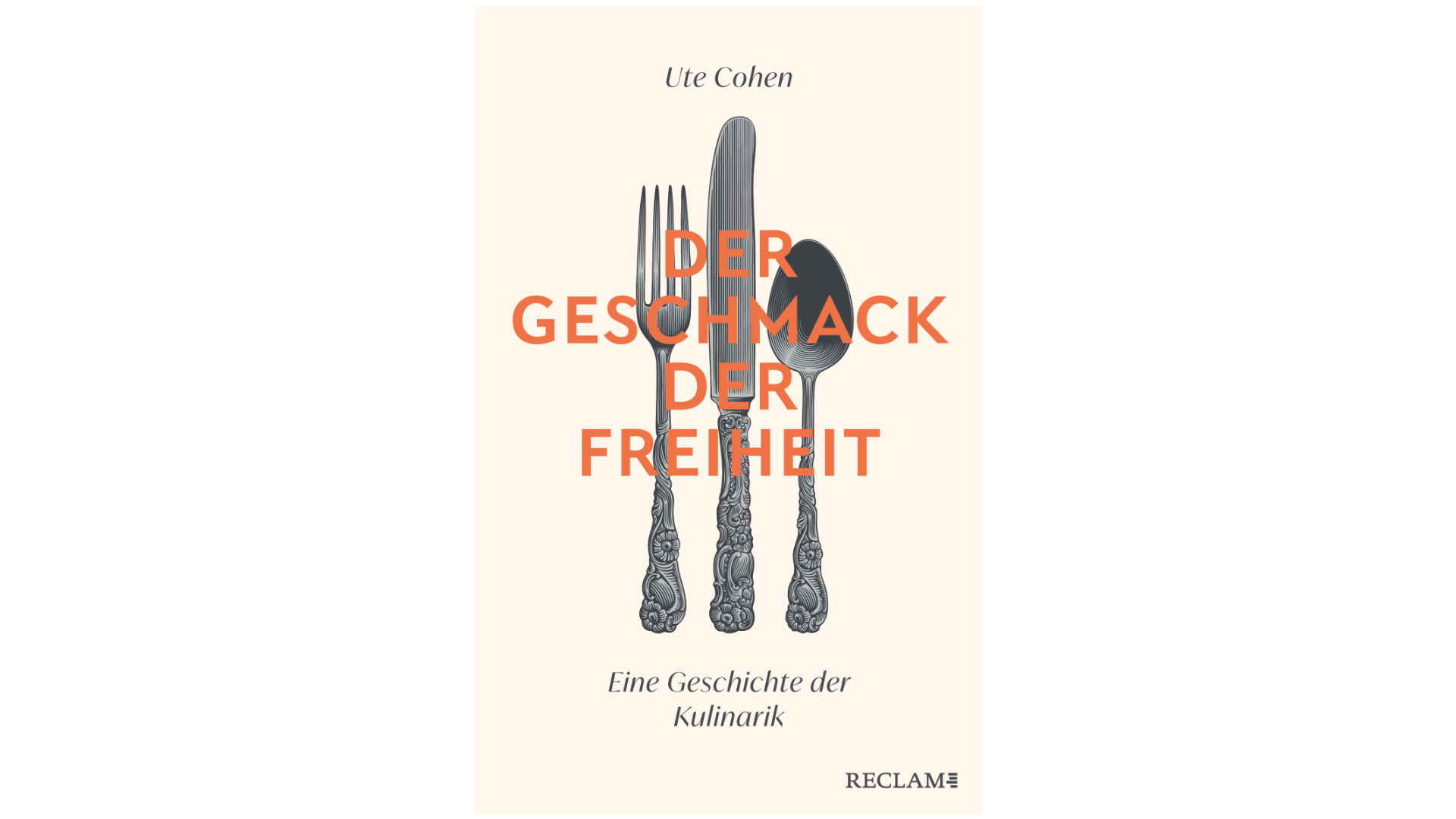
In den letzten zwanzig Jahren waren Naturbelassenheit und Regionalität bei Lebensmitteln wichtige Kriterien. Mit dem Fleischersatz kommt eine ganze Welle an hochverarbeiteten und synthetischen Lebensmitteln auf den Markt. Ist das mit einer Idee von „Kulinarik“ vereinbar?
Das hängt schlichtweg von unserer Kreativität ab. Mir gefällt, was Hervé This, einer der Gründer der Molekularküche, über das Kochen sagt: Cuisine sei „Liebe, Kunst und Technik“. Die Technik nicht als etwas Abstoßendes zu betrachten, sondern als Teil einer köstlichen Trias, wäre ein guter Anfang. Unsere Idee von Natur in Deutschland ist ja sehr romantisch und auch verzerrt. Natur und Kunst sind weniger gegensätzlich, als wir glauben, da unsere Natur selbst bereits domestiziert und von Menschenhand gestaltet ist. Weniger Feindseligkeit gegenüber technischen Neuerungen könnte auch die Kreativität befeuern. Allerdings bleibt noch der ethische Aspekt zu bewältigen. Bei Projekten wie Beyond Meat mit Labor-Gemüse-Burgern oder In-vitro-Fleisch gibt es zwar Fortschritte, es sind aber noch einige Schwachstellen zu beheben. Für die Erzeugung von Laborfleisch war bisher schließlich fetales Kälberserum vonnöten. Die ungeborenen Tiere sterben bei diesem Eingriff. Noch ist schmerzfreier Konsum Zukunftsmusik.
Warum muss es eigentlich Fleischersatz sein, der zum Beispiel Kinder wieder an den „Mythos Fleisch“ bindet, wie Kritiker behaupten?
Zunächst möchte ich bezweifeln, dass es sich um einen Mythos handelt. Fleisch ist vielmehr Teil unseres kulinarischen Erbes, aber nicht überfrachtet mit Symbolen oder gar überirdischen Assoziationen. Gefühle aber und liebgewonnene Erinnerungen sowie Traditionen spielen eine Rolle. Und da halte ich es mit Alexis de Tocqueville: Gesellschaften lassen sich nicht über Gesetze erklären, sondern über die „Gefühle, den Glauben, die Ideen, die Gewohnheiten des Herzens und des Geistes der Menschen, darüber, wie Natur und Erziehung diese Menschen geformt haben“. Wer Ernährungsgewohnheiten ändern will, sollte also nicht nur an den Verstand, sondern auch an das Gefühl appellieren.
Sinnvoll wäre es gewiss, Kulinarik und die Kulturgeschichte unserer Ernährung im Unterricht zu behandeln. In Frankreich gibt es die „semaine du goût“, die Woche des Geschmacks. Kinder lernen dabei, sich auf Neues einzulassen, experimentieren, werden aber auch mit Traditionen und dem kulinarischen Erbe vertraut gemacht. Das wirkt dann auch auf das Elternhaus zurück und kann Routinen wandeln.
„Den Respekt, den man Tieren erweist, sollte man auch seinen Mitmenschen gönnen.“
Wäre es nicht Zeit für eine völlig neue Ernährung?
Eine völlig neue Ernährung? Das klingt mir zu radikal. Vergessen wir mal nicht, dass Revolutionen schnell in Schreckensherrschaften münden. In den letzten Jahren wurden in Frankreich Metzgereien und Käsereien von veganen Kommandos verwüstet. Das hängt auch mit einer zunehmenden Radikalisierung im akademischen und öffentlichen Diskurs zusammen. Den Respekt, den man Tieren erweist, sollte man aber auch seinen Mitmenschen gönnen.
Gesetzliche Bestimmungen und Regeln sind nicht die Lösung, Gewalt ohnehin nicht. Dennoch sollte es bei aktuellen Fleischersatz-Strategien einen Cut geben: Fleisch sollte nicht das Maß der Dinge sein. Solange wir nicht auch sprachlich mit Fleisch als Referenz brechen, wird nichts wahrhaft Neues entstehen. Wir sollten nicht typische Fleischprodukte imitieren, sondern etwas anderes kreieren. Wir lösen uns nicht von alten Gewohnheiten, wenn wir „vegane Metzgereien“ erfinden, und tun so außerdem tradiertem Handwerk unrecht. Wie das aussehen kann? Das können wir gern zusammen austüfteln. Befreien wir unsere in Aspik erstarrten Ideen!